Beim Immobilienkauf denken die meisten nur an den Kaufpreis. Doch der ist nur der Anfang. Wer nicht genau weiß, welche Nebenkosten noch dazukommen, läuft Gefahr, plötzlich zehntausende Euro mehr zu zahlen als geplant. In Dresden, wie in ganz Deutschland, erleben Käufer immer wieder unerwartete Nachforderungen - von Straßenausbaubeiträgen bis zu unklar verteilten Notarkosten. Die Lösung? Nicht auf Gesetze vertrauen, sondern alles im Vertrag festhalten.
Was gehört wirklich zu den Nebenkosten?
Nebenkosten beim Immobilienkauf sind nicht irgendwelche Zusatzkosten. Sie sind Teil des Kaufs, oft teurer als der Kaufpreis selbst. In Deutschland liegen sie zwischen 10 und 15 Prozent des Kaufpreises. Bei einer Immobilie für 400.000 Euro bedeutet das: 40.000 bis 60.000 Euro zusätzlich. Und das ist kein Ausnahmefall - das ist Normalität.Die größten Posten sind:
- Grunderwerbsteuer: 3,5 % bis 6,5 %, je nach Bundesland. In Nordrhein-Westfalen sind es 6,5 %, in Bayern nur 3,5 %. Das ist kein kleiner Unterschied - bei 400.000 € sind das 12.000 € mehr oder weniger.
- Notarkosten: Ca. 1,5 % bis 2 % des Kaufpreises. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer. Der Notar vertritt beide Parteien - und rechnet für seine Arbeit, die Beurkundung, die Eintragung und die Prüfung der Unterlagen ab.
- Grundbuchkosten: Rund 0,5 %. Diese Kosten entstehen, wenn das Grundbuchamt den neuen Eigentümer einträgt. Sie sind oft mit den Notarkosten verwechselt, aber sie sind separat.
- Maklercourtage: Seit Dezember 2020 gilt die gesetzliche Teilung: Käufer und Verkäufer zahlen jeweils die Hälfte. Das sind 3,5 % bis 7 % des Kaufpreises, also 14.000 bis 28.000 € bei 400.000 € - pro Partei die Hälfte.
Dazu kommen noch kleinere, aber nicht weniger gefährliche Kosten: Der Energieausweis (50-300 €, meist vom Verkäufer), die Löschung einer Grundschuld (0,2 % des Wertes), oder eine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn der Verkäufer seinen Kredit vorzeitig zurückzahlt. All das muss im Vertrag stehen - sonst zahlt der, der nicht will.
Warum die Gesetze nicht reichen
Das BGB sagt, wer was zahlen muss. Käufer trägt die Kosten der Beurkundung, Eintragung und Auflassung. Der Verkäufer übernimmt die Kosten der Übergabe. Klingt klar - ist es aber nicht. Denn das BGB ist nur ein Mindestmaß. Im Kaufvertrag kann alles anders geregelt werden - und das wird oft falsch gemacht.Ein typischer Fehler: Der Verkäufer sagt, die Grunderwerbsteuer zahlt der Käufer, weil das „so üblich“ ist. Gesetzlich ist das aber nicht so. Beide Parteien sind gesetzlich mitverpflichtet. Wer das nicht im Vertrag festhält, läuft Gefahr, später vor Gericht zu sitzen - und trotzdem zu zahlen.
Ein Fall aus dem Mietrecht-Report: Ein Käufer in Köln kaufte ein Haus für 320.000 €. Im Vertrag stand nichts über Straßenausbaubeiträge. Ein Jahr später kam die Stadt mit einer Rechnung über 18.500 € - für eine neue Kanalisation, die vor 20 Jahren geplant war. Der Käufer musste zahlen. Weil im Vertrag nicht stand: „Alle bestehenden und zukünftigen Anliegergebühren werden vom Verkäufer übernommen.“
Das ist kein Einzelfall. Laut einer Studie der Universität Hamburg scheitern 62 % der Käufer, die wegen unklarer Nebenkosten klagen. Warum? Weil sie nicht beweisen können, dass der Verkäufer die Kosten hätte tragen müssen. Der Vertrag sagt nichts - also zahlt der Käufer.

Die fünf größten Kostenfallen
Experten wie Rechtsanwalt Markus Schröder aus Berlin listen regelmäßig die häufigsten Fallen auf. Hier sind die fünf, die am meisten schaden:
- Unklare Grunderwerbsteuer-Regelung: Wer zahlt sie? Der Verkäufer, der Käufer, beide? Wenn nicht im Vertrag steht, ist es ein Rechtsstreit.
- Verwechslung von Notarkosten und Grundbuchkosten: Viele glauben, der Notar macht alles. Doch die Grundbuchkosten gehen an das Amt - und werden oft extra berechnet. Das steht nicht automatisch im Angebot.
- Sanierungskosten im Kaufpreis versteckt: Ein Haus wird als „modernisiert“ angeboten. Aber was genau? Wer zahlt, wenn nach dem Kauf rauskommt, dass die Heizung 20 Jahre alt ist? Der Verkäufer muss das im Vertrag klar benennen - sonst ist der Käufer draufgesessen.
- Baulasten und Belastungen: Hat das Grundstück eine Baulast? Ist eine öffentliche Leitung unter dem Garten? Ist ein altes Wohnrecht eingetragen? Das prüft der Notar - aber nur, wenn man ihn dazu auffordert. Im Grundbuch steht es - aber wer liest das vor dem Kauf?
- Keine Pauschale für ungewisse Kosten: Was, wenn die Löschung der Grundschuld teurer wird? Was, wenn die Stadt eine neue Gebühr einführt? Wer zahlt? Ein guter Vertrag legt eine Pauschale fest - z. B. „Alle nicht konkret benannten Kosten bis zu 5.000 € trägt der Verkäufer.“
Die Verbraucherzentrale NRW hat über 40 solcher Kostenfallen dokumentiert. Die meisten sind vermeidbar - wenn man den Vertrag nicht vom Makler oder vom Online-Vorlage-Service unterschreibt, sondern von einem Fachanwalt prüfen lässt.
Wie man sich schützt: Die dreistufige Prüfung
Die Deutsche Anwaltsakademie empfiehlt eine klare, dreistufige Vorgehensweise - und zwar vor der Unterschrift.
- Prüfung des Grundbuchs durch einen Fachanwalt: Kosten: 300-600 €. Der Anwalt prüft: Gibt es Baulasten? Grundschulden? Wohnrechte? Erschließungsbeiträge? Diese Informationen stehen im Grundbuch - aber nur wer sie liest, weiß, was da steht.
- Exakte Auflistung aller Kosten im Vertrag: Nicht „Käufer zahlt die üblichen Nebenkosten“. Sondern: „Grunderwerbsteuer: Käufer. Notarkosten: Käufer. Grundbuchkosten: Käufer. Maklercourtage: Jeweils 50 % Käufer und Verkäufer. Löschung der Grundschuld: Verkäufer. Straßenausbaubeiträge: Verkäufer. Energieausweis: Verkäufer.“ Alles. Jeder Cent. Jeder Cent, der nicht steht, ist ein Risiko.
- Zustandsprüfung durch einen Gutachter: Kosten ab 450 €. Der Gutachter prüft: Ist die Heizung noch tauglich? Ist die Dachdeckung in Ordnung? Gibt es Feuchtigkeitsschäden? Wer zahlt, wenn nach dem Kauf rauskommt, dass die Fassade saniert werden muss? Der Verkäufer - wenn es im Vertrag steht. Sonst der Käufer.
Diese drei Schritte kosten insgesamt etwa 1.500 €. Bei einem Kaufpreis von 400.000 € und typischen Nebenkosten von 50.000 € ist das eine Investition, die bis zu 12.000 € spart - laut Verbraucherzentrale NRW.

Aktuelle Entwicklungen, die Sie kennen müssen
Die Kostenlandschaft ändert sich. Seit Januar 2023 zahlt man in Nordrhein-Westfalen 6,5 % Grunderwerbsteuer - das ist der höchste Satz in Deutschland. Andere Bundesländer überlegen, nachzuziehen. Die Bundesregierung prüft eine bundeseinheitliche Regelung - aber bis das kommt, ist alles unklar.
Die Maklerprovision ist seit 2020 geteilt - aber viele Makler ignorieren das. Sie verlangen weiterhin 7 % vom Käufer. Das ist rechtswidrig. Wer das unterschreibt, zahlt zu viel. Prüfen Sie den Maklervertrag - und fragen Sie nach der Teilung.
Und dann ist da noch die Inflation. Zinsen steigen, Energiekosten klettern, Handwerker werden teurer. Wer heute eine Immobilie kauft, muss mit höheren Sanierungskosten rechnen. Die Kostenfallen werden nicht weniger - sie werden nur größer.
Was passiert, wenn Sie nichts tun?
Ein Käufer aus Leipzig kaufte 2023 ein Einfamilienhaus für 310.000 €. Er vertraute auf den Makler. Der Vertrag stand auf einem Formular. Keine Pauschale. Keine Auflistung. Nach sechs Monaten kam die Stadt mit einer Rechnung über 11.200 € für die neue Gehwegsanierung. Der Käufer musste zahlen. Er klagte - und verlor. Der Richter sagte: „Im Vertrag stand nichts. Dann trägt der Käufer die Kosten.“
Das ist kein Einzelfall. Es ist die Regel. Wer den Vertrag nicht prüft, zahlt. Punkt.
Die gute Nachricht: Sie können das verhindern. Sie brauchen keine Rechtsanwältin zu werden. Aber Sie müssen den Vertrag nicht unterschreiben, bevor er geprüft ist. Holen Sie sich Hilfe. Machen Sie die drei Schritte. Legen Sie alles schriftlich fest. Dann sind Sie nicht der nächste, der 10.000 € mehr zahlt - als geplant.
Wer zahlt die Grunderwerbsteuer beim Immobilienkauf?
Gesetzlich sind Käufer und Verkäufer gemeinsam verpflichtet, die Grunderwerbsteuer zu zahlen. In der Praxis wird sie aber fast immer vom Käufer übernommen - das muss aber im Kaufvertrag ausdrücklich stehen. Wer das nicht regelt, riskiert später Streit. Ein Vertrag, der sagt „Käufer zahlt die Grunderwerbsteuer“, ist rechtssicher. Wer das nicht hat, zahlt vielleicht doch den Verkäufer.
Ist die Maklerprovision immer geteilt?
Ja, seit dem 23. Dezember 2020 ist die gesetzliche Regelung: Käufer und Verkäufer tragen jeweils die Hälfte der Maklercourtage. Das gilt für alle neuen Verträge. Wer weiterhin 100 % vom Käufer verlangt, handelt rechtswidrig. Prüfen Sie den Maklervertrag - wenn dort steht „Käufer zahlt 7 %“, ist das ungültig. Sie dürfen nur die Hälfte zahlen.
Was ist eine Baulast und warum ist sie gefährlich?
Eine Baulast ist eine rechtliche Verpflichtung, die an das Grundstück gebunden ist - zum Beispiel, dass ein Teil des Grundstücks als öffentlicher Weg genutzt werden muss oder dass eine Wand nicht abgerissen werden darf. Sie steht im Grundbuch. Wer sie nicht kennt, kann später nicht bauen, sanieren oder verkaufen. Die Kosten für eine Verletzung können in den fünfstelligen Bereich gehen. Deshalb: Vor dem Kauf immer das Grundbuch prüfen lassen.
Kann ich die Nebenkosten im Kaufvertrag pauschal regeln?
Ja, und das ist oft die beste Lösung. Statt jede einzelne Kostenart aufzulisten, kann man vereinbaren: „Alle nicht explizit genannten Nebenkosten bis zu 5.000 € trägt der Verkäufer.“ Das schützt den Käufer vor unerwarteten Rechnungen. Die Pauschale muss realistisch sein - zu niedrig, und sie ist unwirksam. Zu hoch, und sie schützt nicht. Ein Anwalt hilft, die richtige Summe zu finden.
Wie viel kostet eine professionelle Vertragsprüfung?
Ein Fachanwalt für Immobilienrecht prüft einen Kaufvertrag meist zwischen 500 und 1.200 €. Das klingt viel - aber bei einem Kaufpreis von 400.000 € und typischen Nebenkosten von 50.000 € spart das bis zu 12.000 €. Die Erfolgsquote bei der Vermeidung von Kostenfallen liegt bei über 85 %. Das ist keine Ausgabe - das ist eine Investition.


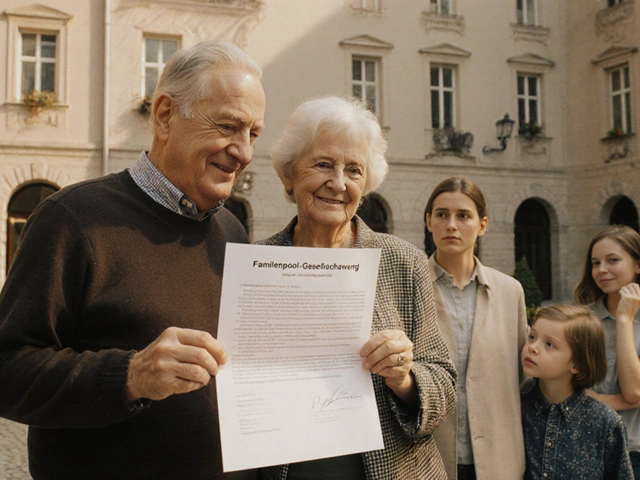


9 Kommentare
Manja Gottschalk
Oh mein Gott, endlich mal jemand, der das sagt! 🙌 Ich hab letztes Jahr 8.000 € für eine Straßenausbaurechnung gezahlt, die im Vertrag NICHT stand… und der Verkäufer hat sich geweigert, was zu zahlen. Jetzt wohne ich in einem Haus mit einem kaputten Gehweg und einem Herzinfarkt. 😭 #Immobilienfallen
Clare Archibald
Lol, natürlich zahlt der Käufer alles. Wer glaubt, Deutschland ist ein Land der Fairness? Die Regierung hat den Verkäufern eine Steuererleichterung geschenkt, und jetzt soll der Käufer dafür büßen? Grunderwerbsteuer 6,5 % in NRW? Das ist kein Steuersatz, das ist eine Enteignung mit Briefkasten. 🇩🇪 #DeutschlandBrauchtKeineImmobilien
Conor Gallagher
Es ist bemerkenswert, wie wenig deutsche Käufer tatsächlich die rechtlichen Grundlagen verstehen. Das BGB ist kein Vorschulbuch, sondern ein komplexes System, das durch Vertragsfreiheit ergänzt wird. Viele glauben, Gesetze schützen sie – aber sie schützen nur, wenn man sie kennt. Ein Anwalt zu konsultieren ist kein Luxus, sondern eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, die sich in 85 % der Fälle amortisiert. Die Verbraucherzentrale hat recht: Es geht nicht um Angst, sondern um Verantwortung. Wer nicht prüft, zahlt – und das ist kein Manko des Marktes, sondern ein Manko der Bildung.
Philipp Cherubim
Ich hab meinen Vertrag von einem Makler aus dem Internet runtergeladen. 300 Euro gespart. 12.000 Euro verloren. 🤦♂️ Jetzt hab ich nen Anwalt, der mir erklärt, warum ‘üblich’ kein Recht ist. Wer das nicht kapiert, kriegt nen neuen Gehweg – und die Rechnung.
jill riveria
Ich hab vor zwei Jahren ein Haus gekauft – und war total verunsichert. Aber ich hab die drei Schritte gemacht: Grundbuch prüfen, Vertrag aufschlüsseln, Gutachter rufen. Hat 1.400 € gekostet. Und ich hab keine Nachzahlung bekommen. Keine Überraschung. Kein Stress. Einfach nur Ruhe. 🌿 Jeder, der denkt, das ist zu teuer, hat noch nie eine Rechnung von der Stadt über 15.000 € gesehen. Es ist kein Luxus – es ist Frieden.
Torsten Muntz
Die Aussage, dass die Maklercourtage seit 2020 geteilt wird, ist irreführend. Die Regelung gilt nur für Verträge, die nach dem 23.12.2020 abgeschlossen wurden. Wer vorher unterschrieben hat, bleibt haftbar. Und viele Makler nutzen das aus – weil die meisten Käufer nicht nachprüfen. Die Verbraucherzentrale sollte Strafen fordern, nicht nur Tipps geben.
Ute Klang
Ich hab’s gewusst!!! Ich hab’s gesagt!!! Ich hab’s gewarnt!!! 🙏 Jeder, der den Vertrag ohne Anwalt unterschreibt, ist ein Held – aber nur im Sinne von ‘Held, der sich selbst opfert’. Das ist kein Mut, das ist Selbstmord mit Grundbuch. Bitte, bitte, bitte: HOLT EUCH HILFE!!!
Niklas Baus
ich hab grad meinen vertrag geprüft und festgestellt, dass da steht ‘käufer zahlt alles’… aber ich hab nich gesehn, dass das mit ‘bis zu 5000€’ gemeint war… ist das legal? oder hab ich mich verlesen? 😅
Melanie Berger
Das ist typisch deutsch: Wir machen alles kompliziert, damit wir uns danach beschweren können. 😏 Aber seriös: Die Pauschale ist der klügste Trick. Nicht jede einzelne Kostenstelle aufzulisten – sondern einen Deckel setzen. Ich hab das bei meiner Wohnung gemacht: ‘Alle unbekannten Kosten bis 6.000 € trägt Verkäufer’. Funktioniert. Kein Stress. Kein Rechtsstreit. Und der Verkäufer war sogar dankbar – weil er auch wusste, wo die Grenze ist. Es geht nicht um Misstrauen – es geht um Klarheit.